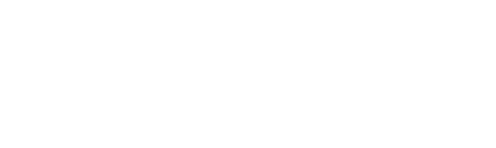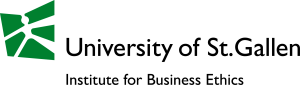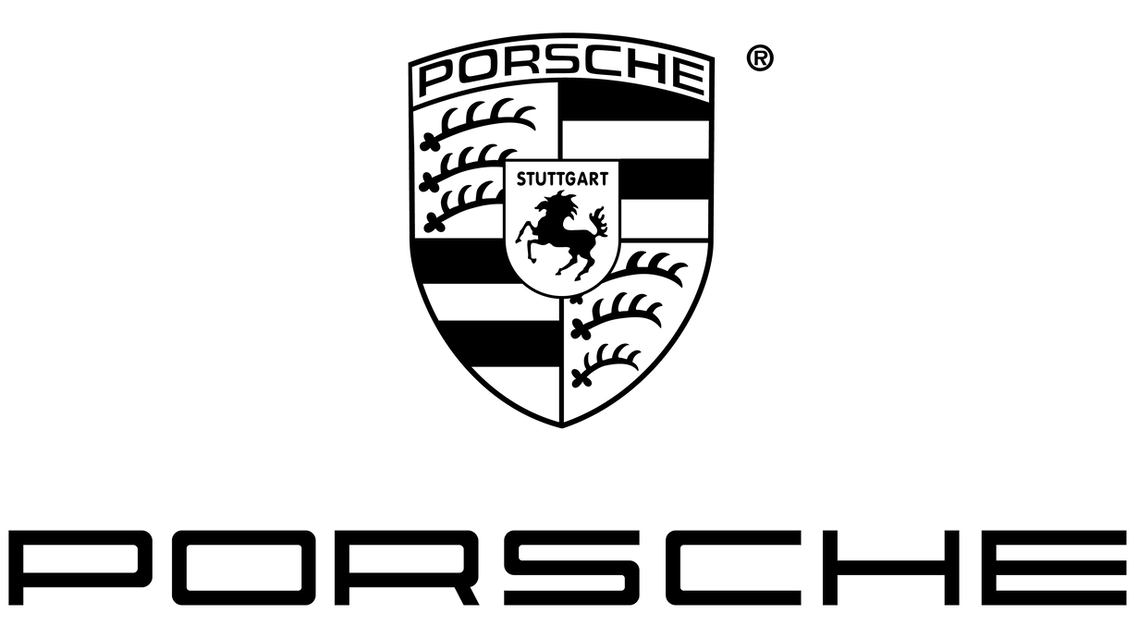Aktuelle Projekte

Mit der Gründung des Future Mobility Lab, gemeinsam mit der Kommunikationsagentur fischerAppelt, haben wir uns zum Ziel gesetzt, realen Einfluss auf individuelles und gesamtgesellschaftliches Mobilitätsverhalten zu nehmen und die gegenwärtige Mobilitätswende aktiv mitzugestalten. Das Future Mobility Lab besteht aus mehr als 20 Mitgliedern, unter anderem Städte, Verbände und zentrale Mobilitätsdienstleister in Deutschland und der Schweiz. Die Mitglieder setzen gemeinsam Studien um, diskutieren die Implikationen der Ergebnisse und zeigen damit die zentrale Bedeutung von Kollaboration zur Gestaltung der Mobilität der Zukunft.
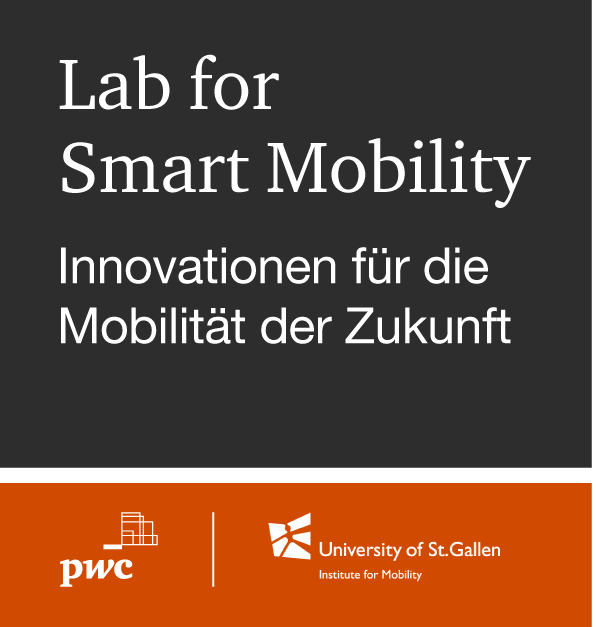
Das „PwC Lab for Smart Mobility“ wurde in Zusammenarbeit mit PwC Deutschland gegründet, um komplexe, vernetzte und nachhaltige Mobilitätsmodelle der Zukunft zu erforschen. Die Denkfabrik wird auch die Auswirkungen dieser Modelle auf das Mobilitätsverhalten untersuchen und sich mit der Standortfrage und zukünftigen Anforderungen der Mobilitätsindustrie auseinandersetzen.
Aktuell fokussiert sich das Smart Mobility Lab auf drei Themenbereiche
- Shared Autonomous Mobility
- Corporate Mobility (in Zusammenarbeit mit dem Future Mobility Lab)
- Public-Private Partnerships
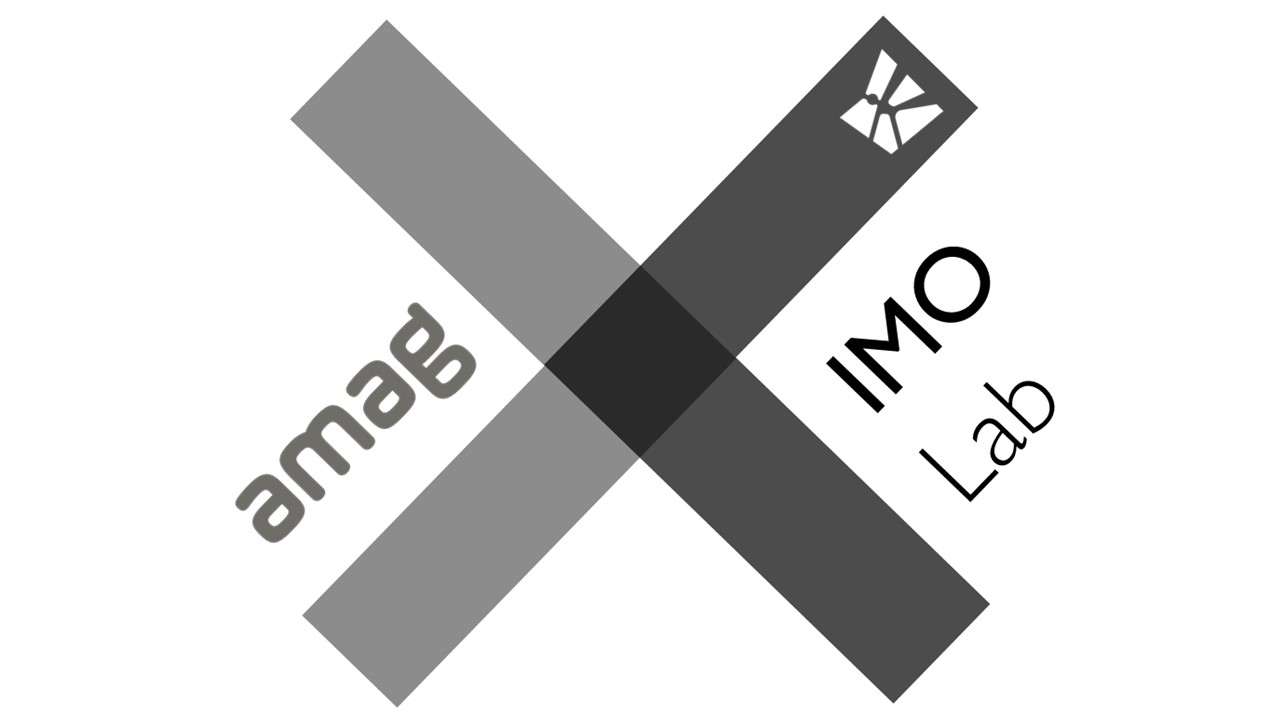
Ein entscheidender Erfolgsfaktor für Mobilitätslösungen ist die enge Zusammenarbeit der Beteiligten. Diese Überzeugung bildet den zentralen Ausgangspunkt für die Arbeit im AMAG x IMO Lab. Durch die Zusammenarbeit mit einem der grössten Anbieter individueller Mobilitätslösungen in der Schweiz entwickeln wir ganzheitliche Konzepte, die die CO2-Emissionen im Verkehr reduzieren. Dabei befassen wir uns mit Forschungsthemen wie Elektromobilität, intelligente Infrastruktur und Mobilitätsdienstleistungssysteme.

Gemeinsam mit dem Touring Club Schweiz (TCS) untersucht das Institut für Mobilität, wie sich das urbane Mobilitätsangebot in der Schweiz in den nächsten 15 bis 20 Jahren entwickeln könnte. Im Zentrum des Projekts steht die Zukunft einzelner Verkehrsträger, ihr Zusammenspiel im Gesamtsystem sowie die Auswirkungen auf den Modalsplit und den infrastrukturellen Bedarf. Auf Basis fundierter Zukunftsszenarien werden Handlungsempfehlungen für Politik und Wirtschaft abgeleitet. Ziel ist es, einen sachlichen und ausgewogenen Beitrag zur Debatte über die (urbane) Mobilität von morgen zu leisten.

Der Innovation Booster New Mobility, initiiert durch Switzerland Innovation, treibt die Entwicklung und Implementierung radikaler Mobilitätslösungen in der Schweiz voran. Mit einem klaren Fokus auf die Förderung eines landesweiten Innovationsökosystems zielt das Programm darauf ab, die Mobilität von morgen effizienter, nachhaltiger und nutzerzentrierter zu gestalten.
Durch die Kombination von Industrie, Start-ups, Wissenschaft und öffentlichem Sektor entstehen interdisziplinäre Netzwerke, die kreative Ideen in marktfähige Innovationen transformieren. Das Programm unterstützt Teams dabei, Herausforderungen wie die Dekarbonisierung des Verkehrs, die Optimierung multimodaler Mobilitätsketten und die Integration neuer Technologien zu lösen.

Gemeinsam mit den Städten Zürich, Basel, Berlin, Düsseldorf und Hamburg untersuchen wir Ansätze für die stadtgerechte Regulierung von geteilter Mikromobilität. Hierbei gilt es insbesondere den Zielkonflikt zwischen Verfügbarkeit für die Nutzenden und einer verträglichen Flottengrösse aufzulösen.
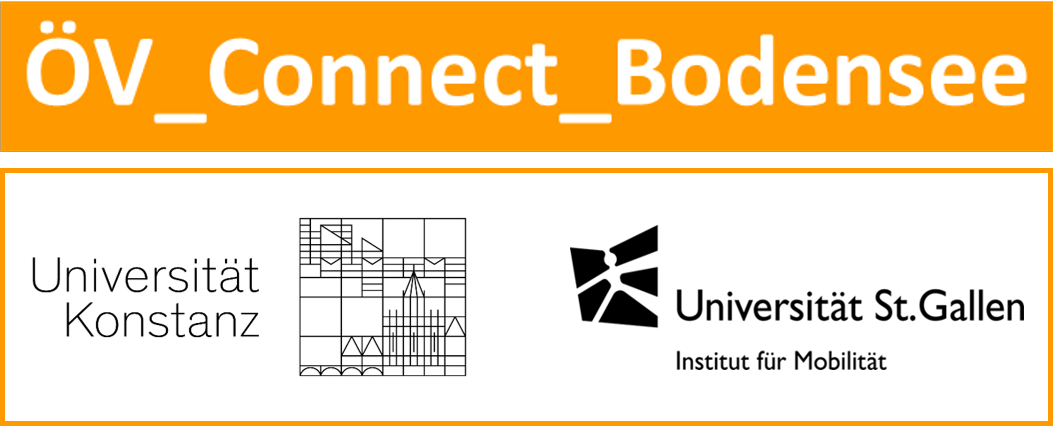
Die Universität Konstanz und die Universität St. Gallen untersuchen im Projekt “ÖV_Connect_Bodensee“ Status Quo und Ursachen von Qualitätsunterschieden im öffentlichen Verkehr in der Bodenseeregion. Dabei werden die administrativen Voraussetzungen für einen hochwertigen öffentlichen Verkehr analysiert und bestehende Qualitätsunterschiede mithilfe einer speziell für den ländlichen Raum entwickelten Methodik identifiziert. Lokale Akteure werden dadurch aktiv unterstützt, die öffentliche Mobilität der Bodenseeregion von morgen zu gestalten.
Abgeschlossene Projekte

Geteilte Mikromobilität, bestehend aus (E-)Bikes und E-Scootern, ist aus vielen Städten nicht mehr wegzudenken. Diese Fahrzeuge können eine besondere Rolle in Kombination mit dem öffentlichen Verkehr spielen, indem sie eine Lösung für die „erste und letzte Meile“ bieten. Um Maßnahmen für eine bessere Integration zwischen öffentlichem Verkehr und Mikromobilität zu untersuchen, hat das Institut für Mobilität ein Projekt-Konsortium gebildet, das alle relevanten Akteure zusammenbringt: Die Verkehrsbetriebe SBB und OSTWIND, den Mikromobilitätsanbieter TIER sowie die Stadt St. Gallen und das Agglomerationsprogramm St. Gallen – Bodensee.
„Multimodal Vernetzt“ konzentriert sich auf zwei Maßnahmen, die in der Region St. Gallen pilotiert wurden: Bundle-Angebote aus Nahverkehr und Mikromobilität sowie der Aufbau von Mikromobilitätsstationen in verschiedenen Siedlungsstrukturen.
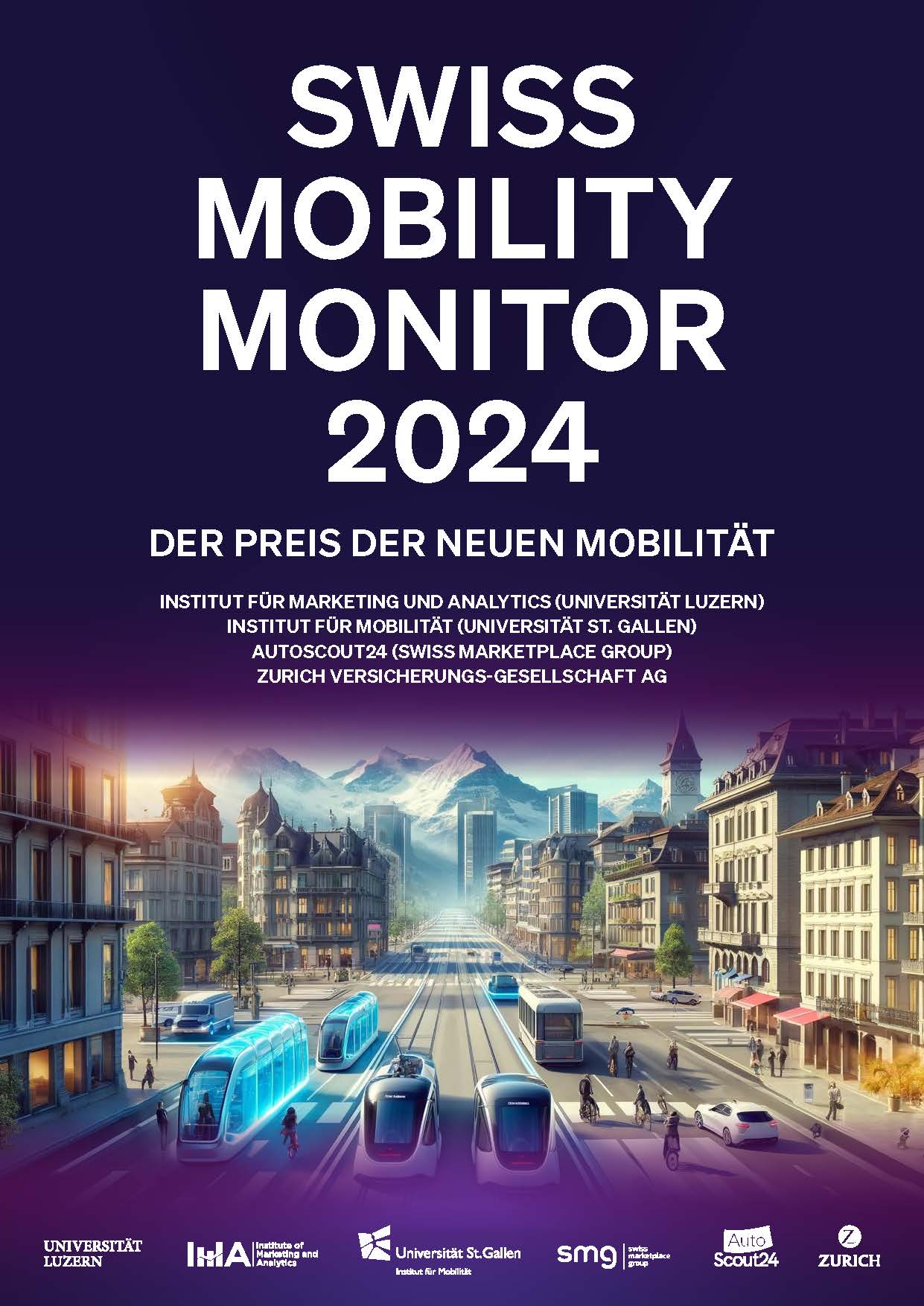
Der Swiss Mobility Monitor ist eine jährliche repräsentative Studie, die das Mobilitätsverhalten der Schweizer Bevölkerung und die Wahrnehmung von Mobilitätsinnovationen herausstellt. Die Ausgabe von 2024 mit dem Titel „Der Preis der neuen Mobilität“ befasste sich beispielsweise mit der Zahlungsbereitschaft für neue Mobilitätsangebote. Die Studie wird vom Institut für Marketing und Analytics (IMA) an der Universität Luzern, der IMO, AutoScout24 (Swiss Marketplace Group) und der Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG durchgeführt – als gleichberechtigte Partner.

In einem gemeinsamen Projekt mit der Sixt SE haben wir ganzheitlich den ökologischen Einfluss von geteilten Mobilitätslösungen im Vergleich zu privat besessener Mobilität untersucht. Neben ökologischen Vor- und Nachteilen erforscht das Projekt auch die Treiber und Barrieren von Nutzern geteilter Mobilität im Hinblick auf batterieelektrische Fahrzeuge. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Frage, wie Nutzer dazu motiviert werden können, umweltfreundlichere Mobilitätslösungen zu buchen. Die Ergebnisse können Mobilitätsanbietern helfen, nicht nur infrastrukturelle und technische Aspekte in ihrer Kommunikation hervorzuheben, sondern auch sozialpsychologische und emotionale Aspekte in ihrer Interaktion mit ihren Kunden zu berücksichtigen.
In Kooperation mit der London School of Economics (LSE Cities) geht es darum, die Gründe zu untersuchen, die Menschen dazu bewegen, vom Auto auf den öffentlichen Verkehr zu wechseln. Hierzu kommen unterschiedliche Erhebungsmethoden zum Einsatz, bis hin zu Preisexperimenten, um die Anreizwirkung des Tarifsystems zu verstehen. Die Daten wurden in der Schweiz und London erfasst, so dass zudem noch ein Vergleich zwischen zwei Kulturkreisen möglich ist.
Mit Toyota soll der Schritt vom Automobilunternehmen zum Mobilitätsdienstleister am Beispiel einer Stadt erarbeitet werden. Hierbei besteht die Idee, eine Neubausiedlung in einer Metropole gleich mit der notwendigen Mobilität zu versorgen. Mobilität als Dienstleistung! Das heisst, Anschluss an eine S- oder U-Bahn, und für den Transport in der Siedlung kommen autonome Busse sowie das ganze Spektrum der Mikromobilität in Betracht.
In einem Projekt mit der Boston Consulting Group sollen die Möglichkeiten aber auch die Hürden für die Verbreitung der Mikromobilität untersucht werden. Hierbei geht es um die Integration dieser Verkehrsmittel in das Tarifsystem des Nahverkehrs bis hin zu Milieubetrachtungen. Wer nutzt eigentlich wann und wo die Mikromobilität? Zudem geht es darum, die Mikromobilität in das bereits existierende Verkehrssystem der Städte einzubinden und einen besonderen Nutzen herauszuarbeiten.
Gemeinsam mit dem World Economic Forum und der Boston Consulting Group sollen die ökonomischen und sozialen Wirkungen einer funktionierenden Mobilität untersucht werden. Könnte das Verkehrssystem nicht der zentrale Treiber sein, um Menschen in Wohlstand und Arbeit zu bekommen? Hierzu sollen die spezifischen Mobilitätsbedingungen in drei Weltregionen betrachtet werden. Mittels einer Simulation lässt sich der Effekt der Mobilität auf Arbeit und Wohlstand bestimmen.
Mobilität kann die Verbesserung der sozioökonomischen Chancen einer Person oder einer Gruppe ermöglichen, indem sie ‘Zugang’ zu Arbeitsplätzen, Bildung oder kultureller Teilhabe ermöglicht. Neue „Shared Mobility“ Angebote (z.B. E-Scooter-Sharing, Car-Sharing, Ride-Sharing,…) erscheinen zwar vielversprechend, werden aktuell aber größtenteils von Menschen aus sozioökonomisch starken Milieus benutzt. Aus wissenschaftlicher und praxisorientierter Sicht stellt sich daher die Frage, wieviel Potenzial für soziale Mobilität in der ‘Shared Mobility’ wirklich steckt und wie dieses Potenzial am besten genutzt werden kann. Diese Forschungsfrage untersuchen wir gemeinsam mit dem Institut für Wirtschaftsethik der Universität St.Gallen.
Ist Mobilität tatsächlich ein Grundbedürfnis? Wie äussert sich dieses Bedürfnis? Was treibe Menschen an, mobil sein zu wollen? Diese Fragen wollen wir im Rahmen eines Projekte mit Porsche beantworten. Es geht um den Stellenwert der Mobilität im Leben der Menschen und den Möglichkeiten, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Interessant hierbei ist, dass der Zugang über verschiedene wissenschaftliche Disziplinen erfolgt und neue Einsichten für die Gestaltung von Verkehrsträgern bringen könnte.