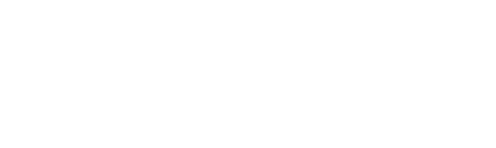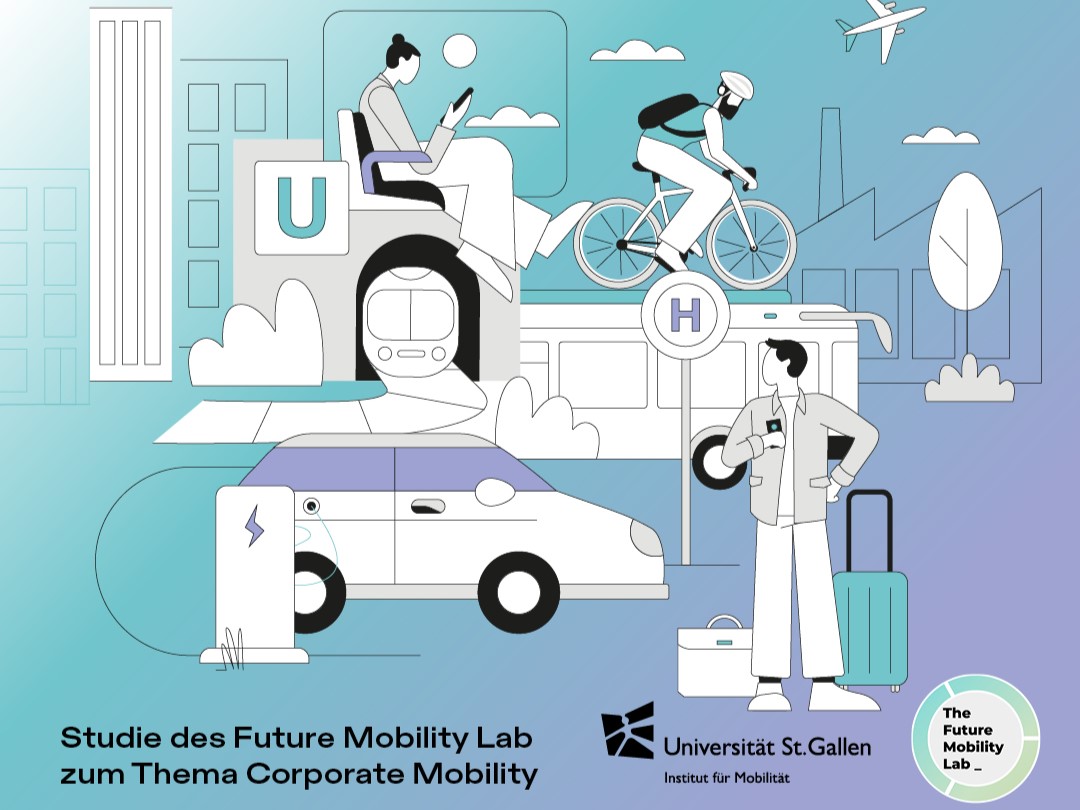St. Gallen / Hamburg, 26. März 2025 – In Deutschland gehen 42 % des Verkehrs auf beruflich zurückgelegte Fahrten zurück. Arbeitgebern kommt dementsprechend eine Schlüsselrolle im Rahmen der nachhaltigen Verkehrswende zu: Sie prägen mit ihren Angeboten für Mitarbeitende einerseits bereits heute das Verkehrsaufkommen; vor allem aber können sie durch die Einführung innovativer Mobilitätsangebote Einfluss auf die Entwicklung des Mobilitätsverhaltens vieler Menschen nehmen. Wie Unternehmen diese Chance und Verantwortung nutzen und welche Bedürfnisse Arbeitnehmende aktuell haben – das hat das Institut für Mobilität der Universität St.Gallen in Kooperation mit der Kommunikationsagentur fischerAppelt und im Rahmen des Future Mobility Lab untersucht.
Die Studie zeichnet sich durch aktuelle Daten, eine umfassende Analyse und eine neue Perspektive auf nachhaltige Mobilitätslösungen aus. Insgesamt wurden 983 Arbeitgeber und 2.922 Arbeitnehmende in Deutschland und der Schweiz befragt. Zudem wurden ausgewählte Unternehmen über einen Zeitraum von sechs bis elf Monaten in der Entwicklung ihrer Mobilitätsangebote begleitet.
Die Mehrheit der befragten Unternehmen gibt an, sich bereits in einem Transformationsprozess ihres Mobilitätsangebots zu befinden. In Deutschland bedeutet das unter anderem eine Ausweitung des Angebots für Dienstrad-Leasing (bei 77 % der befragten Unternehmen), die Elektrifizierung der Pkw-Flotte (72 %), eine Ausweitung der Homeoffice-Optionen (62 %) oder das Angebot eines Deutschlandtickets (52 %). Das Erstaunliche: Die befragten Arbeitgeber wissen in vielen Fällen nur wenig über die genauen Wünsche ihrer Angestellten (43 %); auch herrscht nur wenig Transparenz über die zurückgelegten Arbeitswege, die hierfür genutzten Verkehrsmittel und dementsprechend verursachte Emissionen (66 %). Diese Intransparenz ist aus mehreren Gründen problematisch. Gefragt nach der Wichtigkeit potenzieller Fringe Benefits (also Zusatzleistungen des Arbeitgebers) werden attraktive Mobilitätsangebote von den Arbeitnehmenden bereits an zweiter Stelle genannt – nur geschlagen von zusätzlichen Urlaubstagen. Wer also nicht explizit auf die Wünsche der Belegschaft eingeht, lässt großes Potenzial beim Thema Arbeitgeberattraktivität liegen und somit bei der Bindung bestehender Mitarbeitenden und der Gewinnung neuer Talente. Zudem erschwert die Unkenntnis der zurückgelegten Wege in einigen Fällen eine optimale Ausgestaltung alternativer Mobilitätsangebote sowie ein exaktes Controlling und Reporting der verursachten Emissionen. Auch herrscht hinsichtlich regulatorischer Bestimmungen in vielen Unternehmen Unsicherheit. In Deutschland bilden (steuer-)rechtliche Fragestellungen mit 43 % das größte Hindernis bei der Weiterentwicklung ihrer Angebote (im Vergleich sind dies in der Schweiz lediglich 22 %).
Fünf zentrale Lösungsfelder für eine erfolgreiche Mobilitätswende
Die Untersuchung dokumentiert nicht nur den Status Quo beruflicher Mobilität in Deutschland und der Schweiz, sondern identifiziert fünf strategische Lösungsfelder für die erfolgreiche Weiterentwicklung der beruflichen Mobilität. „Eine erste, aus unserer Sicht positive Beobachtung der Studie ist, dass sich die berufliche Mobilität zunehmend von ihrem bisherigen Fokus auf den individuell genutzten Pkw hin zu einer breiteren Bereitstellung und Nutzung vielfältiger Mobilitätsangebote entwickelt“, sagt Dr. Philipp Scharfenberger, Vizedirektor am Institut für Mobilität der Universität St.Gallen. „Um solche multimodalen Angebote zu fördern und zu organisieren, kommt dem Konzept des Mobilitätsbudgets ein großes Potenzial zu“, ergänzt Luisa Stöhr, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut. Neben der Förderung der Multimodalität (Lösungsfeld 1) und dem Einsatz von Mobilitätsbudgets (Lösungsfeld 2) wurde die zeitgemäße Entwicklung von Reiserichtlinien, gepaart mit einem Wandel der Arbeits- und Meetingkultur, als drittes Lösungsfeld identifiziert. Im vierten Feld geht es darum, Daten gezielt als Grundlage für Entscheidungsprozesse zu nutzen. Das fünfte Feld umfasst die Entwicklung der Organisationsstruktur in Unternehmen im Kontext der Anforderungen an eine neue Mobilität. Aus jedem Lösungsfeld leitet die Studie verschiedene „Key Takeaways“ ab, welche Arbeitgeber bei der Transformation der beruflichen Mobilität unterstützen sollen.
Mobilitäts-Win-Win Situationen schaffen und diese erfolgreich kommunizieren
Eine wichtige Erkenntnis der Mobilitätstransformationen: „Während Arbeitnehmende potenziell von einem breiten Angebot an Mobilitätsoptionen profitieren, können Arbeitgeber beispielsweise durch maßgeschneiderte Budgets, eine effizientere Nutzung von Parkraum oder die Bereitstellung von Mobilitätsdiensten für die private Nutzung nicht nur die Zufriedenheit steigern, sondern auch langfristig Kosten senken. Es entsteht eine echte Win-Win-Situation, die beide Seiten stärkt und nachhaltig zukunftsfähig macht“, sagt Luisa Stöhr. Damit das gelingt, kommt es auch darauf an, neue Mobilitätsangebote attraktiv im Unternehmen zu vermarkten. „Eine frühzeitige und zielgerichtete Kommunikation ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Akzeptanz und Aktivierung – und damit für das Gelingen der Mobilitätswende im beruflichen Kontext“, sagt Marc Recker, Geschäftsführer bei fischerAppelt, relations.
Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die Schlüsselrolle von Arbeitgebern bei der Förderung und Etablierung innovativer Mobilitätskonzepte. Indem Arbeitgeber mit ihren Angeboten immer direkt eine Vielzahl an Individuen erreichen, sind sie ein wichtiger Multiplikator für die Etablierung neuer Mobilitätskonzepte. Zudem können sie für Mobilitätsanbieter ein wichtiger Startpunkt für die breitflächigere Vermarktung innovativer Mobilitätsdienstleistungen sein. So kann ein Angebot, das in einem Unternehmen gut ankommt, gegebenenfalls von dort auch in die breitere Bevölkerung skaliert werden. Berufliche Mobilität hat entsprechend das Potential, Mobilitätsverhalten vieler Menschen zu verändern und neue Impulse in der Mobilitätswende zu setzen.
Zum Studiendesign
Für die umfassenden Ergebnisse haben sich die Wissenschaftler:innen der Universität St.Gallen ein Jahr lang mit der Frage beschäftigt, wie Arbeitgeber und ihre Mitarbeitenden ihre berufliche Mobilität zukunftsorientiert und nachhaltig gestalten können. Dabei wurden mit einer quantitativen Erhebung Arbeitgeber (618 in Deutschland und 365 in der Schweiz) und Arbeitnehmende (1.810 in Deutschland und 1.112 in der Schweiz) befragt. In einem qualitativen zweiten Teil wurden acht Unternehmen aus Deutschland und der Schweiz über mehrere Monate bei der Entwicklung ihres Mobilitätsmanagements begleitet. Hierbei wurden nicht nur aktuelle Mobilitätsangebote untersucht, sondern gemeinsam mit den Organisationen neue Mobilitätskonzepte entwickelt und fallweise mit Mitarbeitenden in Pilotprojekten getestet. Bei der Auswahl der Fallstudienpartner wurde auf die Diversität in Hinblick auf Größe, Raumtyp, Branche und Reifegrad des Mobilitätsmanagements geachtet. Bei den Arbeitgebern handelt es sich um PwC Deutschland, die Wall GmbH, Telekom MobilitySolutions, Endress+Hauser Level+Pressure, BRUSA HyPower AG, Stadt St. Gallen und Swiss International Air Lines.
St. Gallen / Hamburg, 26. März 2025 – In Deutschland gehen 42 % des Verkehrs auf beruflich zurückgelegte Fahrten zurück. Arbeitgebern kommt dementsprechend eine Schlüsselrolle im Rahmen der nachhaltigen Verkehrswende zu: Sie prägen mit ihren Angeboten für Mitarbeitende einerseits bereits heute das Verkehrsaufkommen; vor allem aber können sie durch die Einführung innovativer Mobilitätsangebote Einfluss auf die Entwicklung des Mobilitätsverhaltens vieler Menschen nehmen. Wie Unternehmen diese Chance und Verantwortung nutzen und welche Bedürfnisse Arbeitnehmende aktuell haben – das hat das Institut für Mobilität der Universität St.Gallen in Kooperation mit der Kommunikationsagentur fischerAppelt und im Rahmen des Future Mobility Lab untersucht.
Die Studie zeichnet sich durch aktuelle Daten, eine umfassende Analyse und eine neue Perspektive auf nachhaltige Mobilitätslösungen aus. Insgesamt wurden 983 Arbeitgeber und 2.922 Arbeitnehmende in Deutschland und der Schweiz befragt. Zudem wurden ausgewählte Unternehmen über einen Zeitraum von sechs bis elf Monaten in der Entwicklung ihrer Mobilitätsangebote begleitet.
Die Mehrheit der befragten Unternehmen gibt an, sich bereits in einem Transformationsprozess ihres Mobilitätsangebots zu befinden. In Deutschland bedeutet das unter anderem eine Ausweitung des Angebots für Dienstrad-Leasing (bei 77 % der befragten Unternehmen), die Elektrifizierung der Pkw-Flotte (72 %), eine Ausweitung der Homeoffice-Optionen (62 %) oder das Angebot eines Deutschlandtickets (52 %). Das Erstaunliche: Die befragten Arbeitgeber wissen in vielen Fällen nur wenig über die genauen Wünsche ihrer Angestellten (43 %); auch herrscht nur wenig Transparenz über die zurückgelegten Arbeitswege, die hierfür genutzten Verkehrsmittel und dementsprechend verursachte Emissionen (66 %). Diese Intransparenz ist aus mehreren Gründen problematisch. Gefragt nach der Wichtigkeit potenzieller Fringe Benefits (also Zusatzleistungen des Arbeitgebers) werden attraktive Mobilitätsangebote von den Arbeitnehmenden bereits an zweiter Stelle genannt – nur geschlagen von zusätzlichen Urlaubstagen. Wer also nicht explizit auf die Wünsche der Belegschaft eingeht, lässt großes Potenzial beim Thema Arbeitgeberattraktivität liegen und somit bei der Bindung bestehender Mitarbeitenden und der Gewinnung neuer Talente. Zudem erschwert die Unkenntnis der zurückgelegten Wege in einigen Fällen eine optimale Ausgestaltung alternativer Mobilitätsangebote sowie ein exaktes Controlling und Reporting der verursachten Emissionen. Auch herrscht hinsichtlich regulatorischer Bestimmungen in vielen Unternehmen Unsicherheit. In Deutschland bilden (steuer-)rechtliche Fragestellungen mit 43 % das größte Hindernis bei der Weiterentwicklung ihrer Angebote (im Vergleich sind dies in der Schweiz lediglich 22 %).
Fünf zentrale Lösungsfelder für eine erfolgreiche Mobilitätswende
Die Untersuchung dokumentiert nicht nur den Status Quo beruflicher Mobilität in Deutschland und der Schweiz, sondern identifiziert fünf strategische Lösungsfelder für die erfolgreiche Weiterentwicklung der beruflichen Mobilität. „Eine erste, aus unserer Sicht positive Beobachtung der Studie ist, dass sich die berufliche Mobilität zunehmend von ihrem bisherigen Fokus auf den individuell genutzten Pkw hin zu einer breiteren Bereitstellung und Nutzung vielfältiger Mobilitätsangebote entwickelt“, sagt Dr. Philipp Scharfenberger, Vizedirektor am Institut für Mobilität der Universität St.Gallen. „Um solche multimodalen Angebote zu fördern und zu organisieren, kommt dem Konzept des Mobilitätsbudgets ein großes Potenzial zu“, ergänzt Luisa Stöhr, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut. Neben der Förderung der Multimodalität (Lösungsfeld 1) und dem Einsatz von Mobilitätsbudgets (Lösungsfeld 2) wurde die zeitgemäße Entwicklung von Reiserichtlinien, gepaart mit einem Wandel der Arbeits- und Meetingkultur, als drittes Lösungsfeld identifiziert. Im vierten Feld geht es darum, Daten gezielt als Grundlage für Entscheidungsprozesse zu nutzen. Das fünfte Feld umfasst die Entwicklung der Organisationsstruktur in Unternehmen im Kontext der Anforderungen an eine neue Mobilität. Aus jedem Lösungsfeld leitet die Studie verschiedene „Key Takeaways“ ab, welche Arbeitgeber bei der Transformation der beruflichen Mobilität unterstützen sollen.
Mobilitäts-Win-Win Situationen schaffen und diese erfolgreich kommunizieren
Eine wichtige Erkenntnis der Mobilitätstransformationen: „Während Arbeitnehmende potenziell von einem breiten Angebot an Mobilitätsoptionen profitieren, können Arbeitgeber beispielsweise durch maßgeschneiderte Budgets, eine effizientere Nutzung von Parkraum oder die Bereitstellung von Mobilitätsdiensten für die private Nutzung nicht nur die Zufriedenheit steigern, sondern auch langfristig Kosten senken. Es entsteht eine echte Win-Win-Situation, die beide Seiten stärkt und nachhaltig zukunftsfähig macht“, sagt Luisa Stöhr. Damit das gelingt, kommt es auch darauf an, neue Mobilitätsangebote attraktiv im Unternehmen zu vermarkten. „Eine frühzeitige und zielgerichtete Kommunikation ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Akzeptanz und Aktivierung – und damit für das Gelingen der Mobilitätswende im beruflichen Kontext“, sagt Marc Recker, Geschäftsführer bei fischerAppelt, relations.
Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die Schlüsselrolle von Arbeitgebern bei der Förderung und Etablierung innovativer Mobilitätskonzepte. Indem Arbeitgeber mit ihren Angeboten immer direkt eine Vielzahl an Individuen erreichen, sind sie ein wichtiger Multiplikator für die Etablierung neuer Mobilitätskonzepte. Zudem können sie für Mobilitätsanbieter ein wichtiger Startpunkt für die breitflächigere Vermarktung innovativer Mobilitätsdienstleistungen sein. So kann ein Angebot, das in einem Unternehmen gut ankommt, gegebenenfalls von dort auch in die breitere Bevölkerung skaliert werden. Berufliche Mobilität hat entsprechend das Potential, Mobilitätsverhalten vieler Menschen zu verändern und neue Impulse in der Mobilitätswende zu setzen.
Zum Studiendesign
Für die umfassenden Ergebnisse haben sich die Wissenschaftler:innen der Universität St.Gallen ein Jahr lang mit der Frage beschäftigt, wie Arbeitgeber und ihre Mitarbeitenden ihre berufliche Mobilität zukunftsorientiert und nachhaltig gestalten können. Dabei wurden mit einer quantitativen Erhebung Arbeitgeber (618 in Deutschland und 365 in der Schweiz) und Arbeitnehmende (1.810 in Deutschland und 1.112 in der Schweiz) befragt. In einem qualitativen zweiten Teil wurden acht Unternehmen aus Deutschland und der Schweiz über mehrere Monate bei der Entwicklung ihres Mobilitätsmanagements begleitet. Hierbei wurden nicht nur aktuelle Mobilitätsangebote untersucht, sondern gemeinsam mit den Organisationen neue Mobilitätskonzepte entwickelt und fallweise mit Mitarbeitenden in Pilotprojekten getestet. Bei der Auswahl der Fallstudienpartner wurde auf die Diversität in Hinblick auf Größe, Raumtyp, Branche und Reifegrad des Mobilitätsmanagements geachtet. Bei den Arbeitgebern handelt es sich um PwC Deutschland, die Wall GmbH, Telekom MobilitySolutions, Endress+Hauser Level+Pressure, BRUSA HyPower AG, Stadt St. Gallen und Swiss International Air Lines.